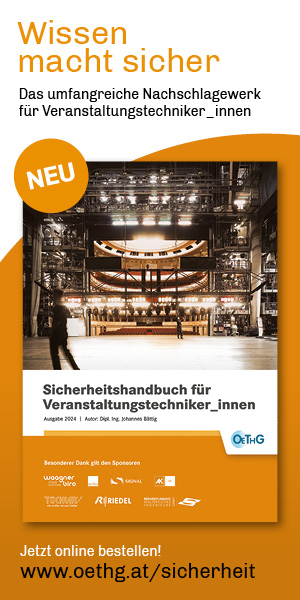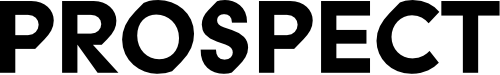„Die Herausforderung war die unterschiedlichen Spielpunkte der Oper auf ein Bühnenbild zu reduzieren und gleichzeitig die emotionalen Gegensätze der gelebten Inhalte angemessen wiedergeben zu können. So entschieden wir uns für ein aus Holz erbautes Schiff.“, erklärt Alexander Egger, technischer Leiter des Innsbrucker Landestheaters. Er fährt weiter fort: „Der Baustoff Holz wurde gewählt, weil der Charakter von Holzpritschen eines Barackenlagers der Konzentrationslager so nachgeahmt werden konnte. So schafften wir die Gegenüberstellung von Luxus und Grauen.“ Das Bühnenbild inklusive Technik sollte die Dramatik des Stücks untermalen. Rund um das pompös aufgebaute Schiff wurden grau lackierte Kleidungsstücke und Schuhe drapiert, als Mahnmal an die Ermordeten der Konzentrationslager. Als Grundstruktur wurden Styropor und Holzplatten verwendet, welche mit Fotodrucken aus grauer Kleidung beklebt wurden, um genauso als Spielfläche zu dienen. Der Aufbau des Schiffs bestand rein aus Holz und einem eingebauten Hebemechanismus, der bei Bedarf das Schiff nach außen öffnen kann. Der einzige Weg auf das Schiff zu kommen ist der mittig platzierte Turm. Er ist mit einer sehr engen Wendeltreppe ausgestattet, um die Schauspielenden auf und ab laufen zu lassen. Zu Höchstzeiten müssen 40 Schauspielende auf dem Dampfer Bewegungsfreiheit haben und sich durch die enge Treppe quetschen. „Statisch und sicherheitstechnisch war der Bau und die Inbetriebnahme des Bühnenbilds eine Herausforderung. Aber besonders unter Betrachtung des Nachhaltigkeitsaspekts wollten wir diese Herausforderung meistern.“, meint Alexander Egger.

Foto ©: Birgit Gufler
Erinnern statt Vergessen
Die Passagierin handelt von der ehemaligen KZ-Aufseherin Lisa, die 15 Jahre nach Kriegsende auf einem Schiff in eine neue Heimat unterwegs ist. On Board trifft sie Martha, einen früheren weiblichen Häftling. Seit ihrer Begegnung wird Lisa von Rückblenden aus ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit heimgesucht. Der Versuch sich einzureden, dass sie wegen ihrer SS-Zugehörigkeit noch lange keine Verbrecherin sei und sie den Krieg vergessen dürfe, schlagen fehl. Ausgangspunkt ist die Perspektive der Täterin Lisa, die ihre Schuld durchgehend zu verharmlosen versucht. Die Szenen finden abwechselnd auf dem Schiff und im Konzentrationslagers Auschwitz statt. Obwohl Lisa permanent versucht sich der deutsch gelebten Vergessens-Kultur hinzugeben, zeigt ihr die Begegnung mit Martha ihre eigene menschliche Fehlbarkeit auf und drängt sie dazu sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Die Oper endet mit Martha, die nach der Überfahrt an ihrem Heimatfluss sitzt und schwört ihren Peiniger:innen niemals zu vergeben. Ein Appell die Vergessens-Kultur aufbrechen zu lassen!

Foto ©: Birgit Gufler
Die Gefahr des Vergessens
Die Oper basiert auf dem autobiografisch geprägten Roman von Zofia Posmysz, einer Überlebenden der Schoa. Selbst mit 18-Jahren ins KZ-Auschwitz deportiert, werden in ihrem Werk die Gräueltaten, sowie das Vergessen der Schoa porträtiert. Opfer und Täterin von Auschwitz erleben auf der gemeinsamen Schiffsfahrt im Jahr 1960 die Erinnerungen an das Grauen das erlebt und begangen wurde. Anstatt aus der Perspektive der Opfer zu erzählen, deren Stimme in diesem Kontext oft vernachlässigt wird, wird der Fokus auf Lisa und ihren innerlichen Zwispalt als Täterin gelegt. Der innere Konflikt der Protagonistin nimmt so viel Raum ein und zeigt ein gängiges Phänomen von Opfer-Täter:in-Umkehr auf. Wie so oft müssen Geschädigte zurückstecken, um den Täter:innen Realisierung und Platz für Aufarbeitung ihrer Taten zu ermöglichen. Die Bedürfnisse von Opfern der Schoa wird am Beispiel von Martha untergraben und unter jene der Täter:innen gestellt. Dieses Problem der Umkehr und des Vergessens konnte Zofia Posmysz auf den Punkt bringen.

Foto ©: Birgit Gufler

Foto ©: Birgit Gufler
 '
'
Foto ©: Birgit Gufler
(lah)