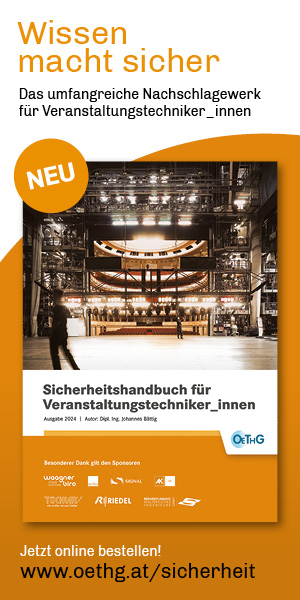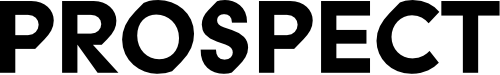Das Ensemble von heute spielt das Ensemble von 1938. Für die respektvolle und sowohl spielerisch als auch technisch grandiose Umsetzung gab es Standing Ovations.
Das Ensemble der Volksoper probte Anfang 1938 die Revue-Operette, „Gruß und Kuss in der Wachau“, ein heiteres Werk um Liebesgeschichten und Heiratssachen. Am 12. März 1938 marschierten deutsche Wehrmachtstruppen in Öster- reich ein. Einen Tag später erließ Hitler die Gesetze zum Anschluss Österreichs. Menschenmassen am Heldenplatz bejubelten Hitler, als er am 15. März 1938 den Eintritt seiner Heimat in das Deutsche Reich verkündete. Der Anschluss wurde mit einer Volksabstimmung am 10. April 1938 nachträglich gebilligt. Der Terror begann schon vor dem Anschluss. Am 12. März 1938 wurden Tausende jüdische Geschäfte geplündert und Menschen misshandelt. In den ersten Ta- gen nach der Machtübernahme wurden 70.000 Menschen verhaftet, vor allem Jüdinnen und Juden. Kurz nach dem Anschluss wurden alle jüdischen Mitglieder der Volksoper entlassen. Einige verließen Österreich und überlebten im Exil, viele wurden ermordet. Die Nationalsozialisten setzten das Stück wenige Wochen nach der Uraufführung ab.
Heile Operettenwelt, grausame Geschichte
„Lass uns die Welt vergessen – Volksoper 1938“ zeigt, wie das politi- sche Geschehen, parallel zu den Proben, in die isolierte Welt der Thea- terleute eindringt. Die Risse werden immer deutlicher. Der niederlän- dische Autor und Regisseur Theu Boermans beleuchtet die Ereignisse von damals und spürt den tragischen Schicksalen der Betroffenen nach. Die israelische Komponistin Keren Kagarlitsky orchestrierte den Klavierauszug der Revueoperette neu und verband ihn mit eigenen Kompositionen sowie mit Musik von Mahler, Schönberg und Ullmann.
Eine Geschichte, verschiedene Blickwinkel
„Lass uns die Welt vergessen – Volksoper 1938“ so stark macht, sind die verschiedenen Blickwinkel, aus denen die Handlung im Kontext der politischen Ereignisse erzählt wird. Die erste Ebene zeigt den hausinternen Alltag in der Volksoper und die Auseinandersetzung mit den aktuellen politischen Ereignissen. Auf der zweiten Ebene wird die Revue-Operette geprobt. Video-Projektionen zwischen diesen beiden Ebenen verknüpfen das Geschehen. Die dritte Ebene zeigt die private Situation des Intendanten und der Darsteller:innen. Eine Kernscheibe fährt aus dem Boden hoch und wird nach außen erweitert. Die technisch aufwendige Installation stellt neun Zimmer dar. Das Licht geht an. Radiogeräte leuchten, Kippa und Menora sind zu sehen. Nationalsozialisten lassen sich in bessere Rollen umbesetzen. Verzweifelte müssen Entscheidungen treffen: bleiben, wegfahren, Abschied nehmen.
Bewegende, bewegte Bilder
Das Stück ist beinahe dokumentarisch. Die künstlerische Anforderung nach synchron bewegten Projektionsflächen erfordert es, neue technische Wege zu beschreiten.
Die Video-Projektion wird den Bewegungen der Bühnenmaschinerie nachgeführt. Obwohl sich in Wirklichkeit nur eine Projektionsfolie bewegt, entsteht so der Eindruck eines sich hebenden Vorhangs oder gemalten Prospekts. Der Beamer ist jedoch fix montiert und die Pro- jektionsfläche deckt den kompletten Portalabschnitt ab. Verschoben wird nur das projizierte Sujet. Wird z. B. der virtuelle Vorhang geho- ben, wird der Bereich unter dem Vorhang nur schwarz bespielt und über der Portalöffnung das Bild abgeschnitten.
Projiziert wird auf eine weiße Gaze, die in einen Prospektzug gehängt ist. Positionsänderungen werden von einem Drehgeber an der Elektrowinde erfasst und über ein Netzwerk an den Bühnencomputer übermittelt. Hier wird die Projektion umge- rechnet und per „PosiStageNet“- Protokoll an den 3D-Tracking-Server weitergegeben. Dieser überträgt die Position in die DMX- Welt und verknüpft sie mit den Vorgaben des Lichtsteuerpultes – Bildauswahl, Mani- pulation und Timing. Dabei kann in jedem Moment festgelegt werden, ob die Bildhöhe dem Zug folgt oder direkt über das Licht- steuerpult kontrolliert wird. Über das Beleuchtungsnetzwerk wird das Summen- signal des 3D-Tracking-Servers an den Me- dienserver übermittelt. Dieser schickt dann den gewünschten Content als Videosignal an den Beamer.
Durch die Zusammenarbeit von Bühnenmaschinerie, Lichtpult, Tracking-Server und Medienserver entsteht der naturalistische Ein- druck für das Publikum. Ing. Christian Allabauer erklärt: „Über die Integration von vier bereits im Haus vorhandenen Netzwerken wird dieser Effekt auf digitalem Weg erreicht. Neben einem Beitrag zur Nachhaltigkeit werden Umbauzeiten vermieden und so dynamische Übergänge zwischen den Handlungsebenen erreicht.“

Die schematische Darstellung der integrierten Netzwerke von Ing. Christian Allabauer.
-apb